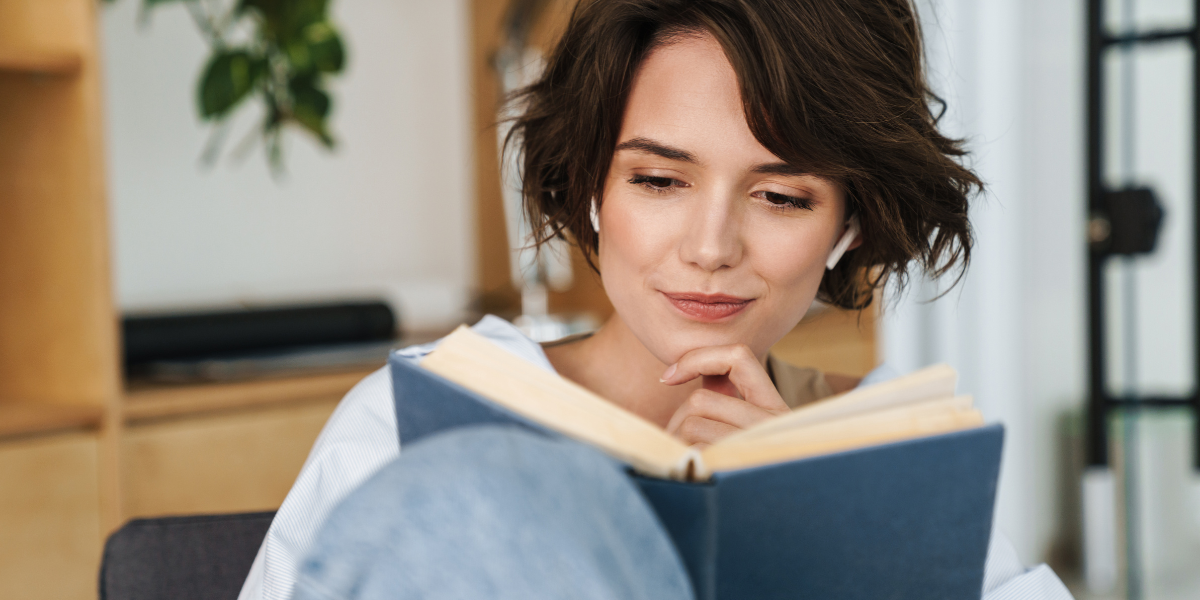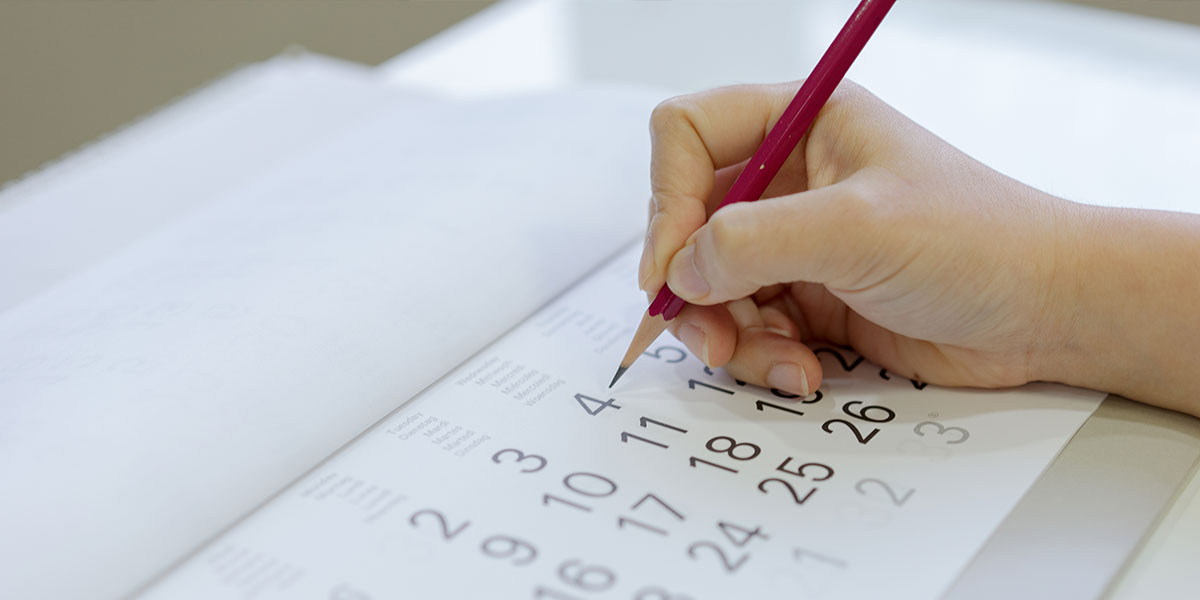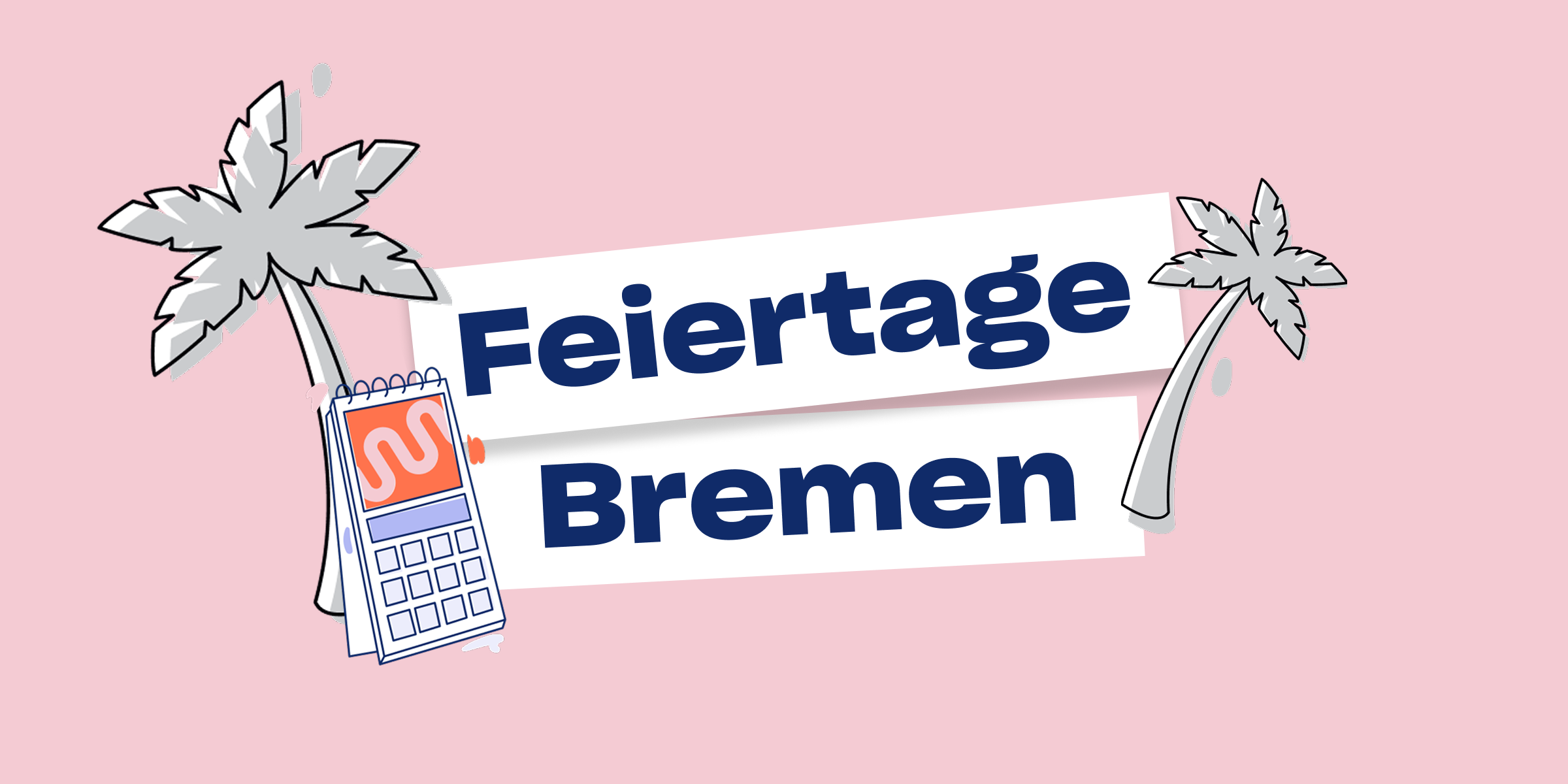„Bin ich ungeeignet in meinem Job?“ – was es mit dem Hochstapler-Syndrom auf sich hat
Das Hochstapler-Syndrom (Impostor-Syndrom) beschreibt Selbstzweifel an den eigenen Fähigkeiten trotz Erfolgen. Betroffene führen Erfolge auf Glück oder äußere Umstände zurück und haben Angst, als inkompetent entlarvt zu werden. Dies äußert sich in Perfektionismus, Versagensängsten oder Vermeidungsverhalten.
Besonders betroffen sind leistungsorientierte Menschen, Berufseinsteiger oder Führungskräfte. Das Syndrom ist keine Krankheit, kann aber zu psychischen Belastungen führen. Ursachen sind Leistungsdruck, Erziehung und Stress.
Im Gegensatz dazu steht der Dunning-Kruger-Effekt, bei dem Inkompetente ihre Fähigkeiten überschätzen. Das Hochstapler-Syndrom belastet auch Teams durch übermäßigen Ehrgeiz und Verzögerungen.
Um es zu überwinden, hilft es, Erfolge zu reflektieren, Perfektionismus zu relativieren, Feedback anzunehmen, negative Denkmuster zu hinterfragen, sich auszutauschen und professionelle Hilfe zu suchen. Der Fokus sollte auf der Teamarbeit liegen.
Hast du schon einmal etwas von dem Hochstapler-Syndrom gehört? Natürlich hat es nichts mit einem Zwang, Bauklötze bis an die Decke zu stapeln zu tun. Und es bezieht sich auch nicht auf Menschen, die ihre Leistungen permanent überbewerten und das öffentlich kundtun, wie man vielleicht zunächst denken könnte. Im Gegenteil: das Hochstapler-Syndrom, auch Impostor-Syndrom genannt, beschreibt ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene trotz offensichtlicher Erfolge und Qualifikationen an ihren eigenen Fähigkeiten im Job zweifeln. Im Extremfall sind Betroffene davon überzeugt, ihre Mitmenschen zu täuschen, weil sie eigentlich gar nichts können.
Vielleicht kommt dir diese Beschreibung bekannt vor, weil du ähnliche Gedanken bei dir selbst oder Kolleg:innen wahrnimmst. Wir erklären dir in diesem Artikel, was es mit dem Hochstapler-Syndrom auf sich hat, welchen Einfluss es auf dein Berufsleben haben kann und was du dagegen tun kannst.
Woran erkennt man das Hochstapler-Syndrom?
Menschen mit Hochstapler-Syndrom führen Erfolge im Beruf nicht auf die eigene Leistung zurück, sondern auf externe Faktoren: Man hatte Glück, es gab keine Konkurrenz, die Vorgesetzten waren nachsichtig… Dass die Beförderung wegen guter Leistung und außergewöhnlichem Einsatz erfolgte, wird ausgeblendet. Für Außenstehende ist das oft gar nicht nachvollziehbar, aber Menschen mit Hochstapler-Syndrom scheinen ihre eigene Leistung nicht anerkennen zu können. Häufig treten verschiedene Anzeichen zusammen auf bei Menschen mit Impostor-Syndrom. Zu den typischen Merkmalen gehören:
- Selbstzweifel trotz Erfolg: Betroffene glauben, ihre Leistungen seien nicht auf ihre Fähigkeiten, sondern auf Glück oder äußere Umstände zurückzuführen.
- Perfektionismus: Sie setzen sich unrealistisch hohe Standards und empfinden Fehler oder kleinste Schwächen als persönliches Versagen.
- Angst vor Entlarvung: Es besteht die ständige Sorge, dass andere ihre vermeintliche Inkompetenz entdecken könnten.
- Vergleiche mit anderen: Betroffene messen sich häufig an anderen und fühlen sich dabei oft unterlegen, auch wenn objektiv kein Grund dafür besteht.
- Schwierigkeiten, Lob anzunehmen: Anerkennung oder Komplimente werden als unverdient abgetan oder heruntergespielt.
- Überarbeitung oder Vermeidung: Manche kompensieren ihre Unsicherheit durch übermäßigen Arbeitseinsatz, während andere Aufgaben aus Angst vor dem Scheitern vermeiden.
Wie zeigt sich das Hochstapler-Syndrom im Arbeitsalltag?
Das Hochstapler-Syndrom kann sich am Arbeitsplatz in zwei ganz unterschiedlichen Mustern zeigen: Übermäßige Leistung oder vollständige Vermeidung. Bei der ersten Strategie bereiten sich die Betroffenen akribisch auf Herausforderungen vor, erbringen in der Regel ausgezeichnete Leistungen, sind jedoch selten wirklich zufrieden mit dem Ergebnis und laufen Gefahr, eine Angst vor der Arbeit zu entwickeln. Aber das Hochstapler-Syndrom kann auch genau ins Gegenteil umschlagen, indem sich Betroffene dem Stressor entziehen, indem sie Aufgaben aufschieben oder vermeiden, sich aus Projekten herausziehen, auf E-Mails oder Anfragen nicht reagieren.
Beide Strategien sind nicht nachhaltig: Betroffene, die zur Überperformance neigen, können sich in einen Teufelskreis manövrieren, in dem sie ihre Leistung immer wieder selbst übertreffen wollen. Dies kann zu einer Überlastung und psychischen Erkrankungen wie einem Burn-Out führen (https://news.kununu.com/burnout-wenn-die-arbeit-krank-macht/), wenn Betroffene nur noch für ihren Beruf leben. Personen, die eher zur Vermeidung neigen, empfinden zunächst Erleichterung, wenn sie Aufgaben aufschieben können, doch die Versagensangst bleibt bestehen, da die zugrunde liegende Herausforderung ungelöst bleibt. Wer permanent Leistung verweigert, wird über kurz oder lang Konsequenzen im Beruf zu spüren bekommen, im schlimmsten Fall droht die Kündigung.
Bei welchen Personen tritt das Impostor-Syndrom auf?
Betroffene Personen fühlen sich wie Betrüger:innen und haben die ständige Angst, als inkompetent entlarvt zu werden. Diese Selbstzweifel treten häufig bei besonders leistungsorientierten, gut ausgebildeten Menschen auf, die den Anspruch an sich haben, alles perfekt zu machen. Wenn dieser Leistungsanspruch mit einem eher unsicheren Auftreten und einem wenig ausgeprägten Selbstbewusstsein kombiniert auftritt, ist das der perfekte Nährbodenfür die Entwicklung des Hochstapler-Sydroms . Häufig sind Berufseinsteiger:innen betroffen, die sich in der neuen und unbekannten Umgebung behaupten müssen. Das gilt besonders, wenn talentierte junge Menschen schnell Karriere machen und erfahrenere Kolleg:innen “überholen”. Statt auf ihre Arbeit stolz zu sein, empfinden Betroffene den eigenen Erfolg als ungerechtfertigt. Doch auch bei erfahrenen Führungskräften kann das Hochstapler-Syndrom auftreten. Je höher man auf der Karriereleiter steht, desto mehr Verantwortung trägt man auch für andere Menschen und den Erfolg des Unternehmens. Gleichzeitig gibt es in vielen Führungsrollen keine klaren Parameter, an denen sich messen lässt, wie gut die eigene Arbeitsleistung ist. Diese Situation kann dazu führen, dass man die eigene Leistung immer wieder hinterfragt. Studien zufolge sind Frauen häufiger vom Impostor-Syndrom betroffen als Männer, vielleicht weil Frauen eher dazu neigen, perfektionistisch zu sein und es allen recht machen zu wollen.
Ist das Hochstapler-Syndrom eine Krankheit?
Nein, bei dem Hochstapler- oder Impostor-Syndrom handelt es sich nicht um ein Krankheitsbild, sondern vielmehr um ein Persönlichkeitsmerkmal, das stärker oder schwächer ausgeprägt vorliegen kann. Expert:innen sprechen daher auch eher vom Impostor-Phänomen oder vom Hochstapler-Muster, als den krankheitsbezogenen Begriff -Syndrom zu benutzen. Auch wenn es keine offizielle Krankheit ist, können Betroffene sehr stark unter dem Hochstapler-Syndrom leiden, weshalb man das Phänomen auf jeden Fall ernst nehmen sollte, um eine psychische Erkrankung als Folge des Impostor-Syndroms zu vermeiden.
Was sind die Ursachen für das Hochstapler-Syndrom?
Wie und warum sich ein Impostor-Syndrom herausbildet, lässt sich schwer analysieren. Es scheint gesichert, dass die Genetik eine Rolle spielt, schließlich wird unsere Persönlichkeit auch von unseren Genen beeinflusst. Aber auch die Erziehung, in der Schule wie in der Familie, spielt eine Rolle. Wer schon als Kind einem hohen Leistungsdruck ausgesetzt ist und die entsprechende Persönlichkeitsstruktur mitbringt, wird sich und die eigene Leistung als erwachsene Person vielleicht stärker in Frage stellen. Wenn du selbst betroffen bist, kannst du dich vielleicht daran erinnern, dass du schon in der Schule deine Leistung in Frage gestellt hast. Stress und Druck im Beruf oder eine toxische Arbeitsumgebung können das Hochstapler-Syndrom triggern.
Das Gegenteil des Hochstapler-Syndroms: Der Dunning-Kruger-Effekt
Der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt eine kognitive Verzerrung, die sich genau konträr zum Hochstapler-Syndrom zeigt: Der Effekt beschreibt Menschen mit geringem Wissen oder geringer Kompetenz in einem bestimmten Bereich, die ihre Fähigkeiten überschätzen. Betroffene schätzen ihre Leistungen besser ein als sie tatsächlich sind. Gleichzeitig unterschätzen sie die Fähigkeiten anderer, was dazu führt, dass sie ihre Position oder ihr Wissen als überlegen wahrnehmen. Konstruktive Kritik wird oft nicht ernst genommen, da sie ihre fehlerhafte Selbstwahrnehmung nicht infrage stellen können. Im beruflichen Kontext werden diese Personen häufig zunächst oft als charismatisch, wissend und selbstsicher wahrgenommen. Im Team können Personen mit dem Dunning-Kruger-Effekt für ein negatives Klima sorgen, wenn die Kolleg:innen feststellen, dass sich hinter der Fassade wenig Leistung verbirgt.
Warum das Hochstapler-Syndrom auch den Rest des Teams belastet
Das Hochstapler-Syndrom kann nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Kolleg:innen im Team sehr anstrengend sein. Die ständigen Selbstzweifel der betroffenen Person können eine belastende Dynamik erzeugen. Betroffene legen häufig übermäßigen Ehrgeiz und Perfektionismus an den Tag, was dazu führen kann, dass der Rest des Teams unter Druck gerät, ähnliche Standards zu erfüllen. Gleichzeitig hinterfragen sie ihre Leistungen so stark, dass Entscheidungen und Prozesse unnötig verzögert werden. Ihre Tendenz, eigene Erfolge kleinzureden, kann außerdem frustrierend sein, da sich Kolleg:innen in ihren Bemühungen, die Person zu unterstützen oder anzuerkennen, nicht ernst genommen fühlen. Auch wenn nur eine Person im Team Verhaltensweisen des Impostor Syndroms an den Tag legt, kann das die Zusammenarbeit und die Teamatmosphäre nachhaltig belasten. Führungspersonen sollten daher geschult sein, die Merkmale des Hochstapler Syndroms (sowie des Dunner-Kruger-Effekts) zu erkennen und die Teammitglieder dabei unterstützen, sich mit ihren Verhaltensweisen auseinanderzusetzen.
Tipps: Wie du das Hochstapler-Syndrom überwindest
Zunächst einmal ist es grundlegend, dass Betroffene erkennen und sich bewusst machen, dass ihre ständigen Selbstzweifel keine Grundlage haben. Wenn das Bewusstsein für das Impostor Syndrom vorhanden ist, können verschiedene Strategien dabei helfen, die eigenen Gedanken und Handlungen bewusster zu steuern und den gewohnten Mustern zu entkommen.
- Erfolge bewusst reflektieren:
Statt Erfolge kleinzureden, sollten Betroffene sich bewusst machen, was sie erreicht haben und welche Fähigkeiten dazu beigetragen haben. Tipp: Erstelle eine Liste mit deinen Erfolgen oder positivem Feedback und aktualisiere und reflektiere sie am Ende einer Arbeitswoche.
- Perfektionismus relativieren:
Es ist wichtig zu akzeptieren, dass Fehler zum Lernprozess gehören und niemand perfekt ist. Tipp: Setze dir realistische Ziele, die du erreichen kannst.
- Offenheit für Feedback:
Konstruktives Feedback von Kolleg:innen oder Vorgesetzten sollte als Chance betrachtet werden, die eigene Perspektive zu erweitern. Tipp: Lerne, Lob und Anerkennung anzunehmen und vielleicht sogar zu genießen. Wenn Kolleg:innen oder Vorgesetzte dich loben, dann hat das einen Grund!
- Negative Denkmuster hinterfragen:
Automatische Gedanken wie „Ich bin nicht gut genug“ sollten bewusst überprüft werden. Tipp: Wenn sich der “Ich bin nicht gut genug”-Gedanke das nächste Mal breit macht, kann dir vielleicht ein Trick helfen: Stell dich aufrecht in Super Man- beziehungsweise Super Woman-Pose hin und sage laut: “Ich schaffe das, denn ich weiß, was ich tue.” Studien zu Folge reduziert das sogenannte Power-Posing den Stresslevel und erhöht den Testosteron-Spiegel.
- Austausch suchen:
Gespräche mit Kolleg:innen, Freund:innen oder Mentor:innen können helfen, eine realistischere Sichtweise auf die eigene Kompetenz zu gewinnen. Tipp: Teile deine Selbstzweifel mit einer Person, der du vertrauen kannst – du wirst sehen, dass dein Selbstbild nicht mit dem Fremdbild übereinstimmt.
- Professionelle Unterstützung:
In schwerwiegenden Fällen kann eine Therapie oder ein Coaching hilfreich sein, um die zugrunde liegenden Muster zu erkennen und aufzuarbeiten. Tipp: Wenn dein Leidensdruck groß ist und du das Gefühl hast, selbst nichts gegen die Gedankenmuster des Hochstapler-Syndroms tun zu können, solltest du dir Hilfe suchen. Viele Firmen bieten entsprechende Angebote, um ihre Mitarbeiter:innen zu unterstützen. - Du bist Teil eines Teams:
Statt den Fokus nur auf die eigene Leistung zu legen, sollten Betroffene lernen, sich als Teil eines Teams zu sehen. Dies mindert das Gefühl, allein verantwortlich für Erfolge oder Misserfolge zu sein. Nein, ob die morgige Präsentation ein Erfolg wird oder nicht, hängt nicht nur von dir ab. Tipp: Lerne es zu schätzen, dass du Teil eines Teams bist und dass du dich auf andere verlassen kannst.